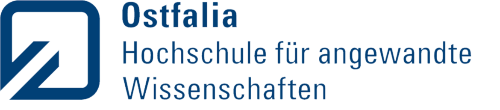Deutsche Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
Fachgruppe Medienökonomie
Call for Abstracts
Tagung vom 17. bis 19. September 2025
an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Salzgitter
Medienökonomie im Postdigitalen: Neue Perspektiven auf Polykrisen, Plattformen und Produktionsroutinen
Einreichungsfrist: 31.05.2025
Die Tagung widmet sich den Herausforderungen einer postdigital geprägten Welt. Diese zeichnet sich bekanntermaßen dadurch aus, dass der gesamte Alltag digital durchdrungen ist (Klein, 2019; Kölmel & Sumi, 2024). In einer so verstandenen Postdigitalität wird nicht länger zwischen hier digital und dort analog unterschieden (Jandrić, 2023). Was folgt auf die bereits zur 2013er-Tagung der Fachgruppe in Salzgitter bemühte „Entmaterialisierung der Medienwirtschaft“ (Rau, 2014), auf eine angebots- wie nachfragezentrierte Plattformisierung (Wellbrock & Buschow, 2020), auf eine bereits in den 1980er Jahren prognostizierte Konvergenz multimedialer Produktionsroutinen (Gebesmair & Nölleke-Przybylski, 2020), die sich heute auch an den Hochschulen in einschlägigen Curricula wiederfindet (z.B. „Digitales Storytelling“ am Tagungsort)? Am Ende steht Postdigitalität begrifflich auch für die Kritik an bisherigen Diskursen der digitalen Transformation (Dander, 2020).
Medienökonomie an der Schnittstelle von Kommunikations-, Medien- und Wirtschaftswissenschaften ist eine Zwischen-den-Stühlen-Disziplin und nach wie vor im Kanon unterrepräsentiert (Jarren, 2016). Aus Sicht der Fachgruppe muss das zwingend als Fehler bezeichnet werden. Sie begründet ihre Tradition sowohl betriebswirtschaftlich (Mierzejewska & Kolo, 2019; Wellbrock & Zabel, 2020), finanzwissenschaftlich (Musgrave, 1957; Rau, 2022) wie eben auch nichtmarktökonomisch (Gonser & Gundlach, 2016; Kops, 2016). Man kann es auch einfacher formulieren: Postdigitalität braucht kritische Medienökonomie, die auch die alte Frage von Profit vs. Vielfalt (Prokop, 1973) neu verortet. Gemeinsam können wir als Fachgruppe Medienökonomie in Salzgitter die Wechselwirkungen zwischen wirtschaftlichen Strukturen, menschlichem Handeln und technologischen Entwicklungen neu vermessen.
Gesucht werden Beiträge, die theoretisch anschlussfähig und/oder empirisch ambitioniert die Rolle der Medienökonomie in einer postdigitalen Gesellschaft diskutieren. Dabei schwingt immer die Frage mit, inwieweit Medienökonomie für sich einen Sonderstatus beanspruchen darf (Picard, 2006) oder ob sie angesichts der Dominanz natürlicher Internetmonopole (Daum, 2017) obsolet geworden ist.
Damit rücken zusammenfassend im Sinne des Calls besonders Überlegungen ins Blickfeld, die die Rolle der Medienökonomie im Zusammenhang mit Postdigitalität diskutieren und hinterfragen.
Fragen zum Weiterdenken:
- Liefert die von Disruption, Polykrisen und anhaltender Transformation geprägte Medienbranche Blaupausen für zukunftsfähige Geschäftsmodelle?
- Kann Medienökonomie nach wie vor einen Sonderstatus in den Wirtschaftswissenschaften beanspruchen? Und ist das berechtigt?
- Wie beeinflussen plattformökonomische Zwänge eine zukunftsorientierte Erstellung von Inhalten?
- Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in einer Medienökonomie der Postdigitalität?
- Wie sehen KI-getriebene Geschäftsmodelle in der Medienproduktion aus, wie könnten sie aussehen, und welche Rolle spielt Originalität in diesem Kontext?
- Wie wäre ein postdigitaler Regulierungsanspruch konkret zu formulieren?
- Wie sind Technologisierung, Plattformisierung, Kommerzialisierung oder gar Kommodifizierung zusammenzudenken (z.B. bezogen die kommerzielle Filmwirtschaft als wirtschaftliche Institution, Regulierungsobjekt und Technologietreiber)?
- Gibt es schon heute so etwas wie „Best Practice AI“ in der Anwendung – z.B. in Form von Case-Studies aus der angewandten Medienpraxis?
- Ist Medienökonomie in zunehmendem Maße auch eine Ökonomie der Games (wenn man z.B. ihre Produktion, die Inhalte, das Publikum und Möglichkeiten der Regulierung betrachtet)? Was wäre mit AR und VR und Angeboten aus der Familie der Serious Games?
- Welchen Einfluss haben ganz grundsätzlich veränderte Routinen der Konsumtion auf die Inhalteerstellung (z.B. im datafizierten journalistischen Betrieb der Nachrichtenerstellung)?
- Welche theoriegetriebenen, ökonomisch motivierten Positionen lassen sich für die postdigital geprägte Medienwelt einnehmen, verteidigen oder kritisieren?
- Wie wird eine kommunikationswissenschaftlich geprägte Medienökonomie in Zukunft über monetäre Gewinnmaximierung hinausdenken? Welche Bedeutung spielen Nichtmarktökonomie und Meritorik in diesem Kontext?
- Das Publikum und die Medienökonomie – Welche von massenmedialem Denken entkoppelte Rollen und Funktionen (oder auch Stereotype) müssen mitgedacht werden?
Format der Beiträge
Die Tagung bietet Raum für Beiträge, die das beschriebene Feld aus theoretischer, empirischer und methodischer Perspektive ausleuchten. Eingereicht werden können anonymisierte Extended Abstracts (max. 6.000 Zeichen zzgl. Literaturverzeichnis). Beiträge dürfen zum Zeitpunkt der Einreichung noch nicht publiziert oder auf anderen Tagungen vorgestellt worden sein. Wie in Vorjahren wird es neben dem Schwerpunkt der Tagung ein offenes Panel geben. Somit bietet sich auch die Gelegenheit, aktuelle Forschungsergebnisse zu Medienökonomie und Medienmanagement jenseits des Tagungsthemas zu präsentieren und zu diskutieren. Hierfür werden Beiträge erwartet, die sich theoretisch und methodisch fundiert mit relevanten Fragestellungen der Medienökonomie auseinandersetzen.
Eingereicht werden können zusätzlich ganze Panels oder neue Formate – so, wie wir dies bei der Fachgruppentagung im Jahr 2023 in Stuttgart schon erprobt haben. Für diese Formate wird ein Zeitrahmen am Freitag fest eingeplant.
Begutachtung und Auswahl
Alle Einreichungen werden im Double-Blind-Peer-Review der DGPuK-Fachgruppe Medienökonomie begutachtet und auf Grundlage von mindestens zwei Reviews ausgewählt.
Folgende Kriterien entscheiden dabei über Annahme und Ablehnung:
- Passung zum Thema der Tagung (mit Ausnahme der Einreichungen zum offenen Panel)
- Originalität des Beitrages
- Schlüssigkeit des theoretischen Zuganges
- Methodische Stringenz
- Prägnanz der Argumentation
Die bei der Tagung präsentierenden Teilnehmer:innen sind ebenfalls dazu eingeladen, ihren Beitrag zur Publikation in den Proceedings der Jahrestagung einzureichen.
Ablauf der Tagung
- Mittwoch, 17.09.2025: 10:00 PhD Workshop von Medienökonomie JR, 14:00/15:00 Methodenpanel, 19:00 Get Together (Salzgitter-Lebenstedt – Lokalität wird noch festgelegt)
- Donnerstag, 18.09.2025: 9:00 Tagungsbeginn, 18:00 Fachgruppensitzung, 19:00 Sektempfang (Salzgitter, Campus), 19:30 Empfang/Gala (Salzgitter, Historische Lohnhalle)
- Freitag, 19.09.2025: 9:30 Tagungsbeginn, 13:00 Mittagessen, Verabschiedung
Im Rahmen der Tagung wird die Fachgruppe Medienökonomie erneut ihren Nachwuchspreis verleihen, dotiert mit einem Preisgeld von 600,- Euro. Hierzu erfolgt eine separate Ausschreibung.
Kontakt: m.ollrog@ostfalia.de / Prof. Dr. Marc-Christian Ollrog
Institutsleiter Institut für Öffentliche Kommunikation, Ostfalia Hochschule
Literatur
Dander, V. (2020). Sechs Thesen zum Verhältnis von Bildung, Digitalisierung und Digitalisierung. In V. Dander, P. Bettinger, E. Ferraro, C. Leineweber & K. Rummler (Hrsg.), Digitalisierung – Subjekt – Bildung: Kritische Betrachtungen der digitalen Transformation (S. 19–37). Opladen: Verlag Barbara Budrich.
Daum, T. (2017). Das Kapital sind wir: Zur Kritik der digitalen Ökonomie. Hamburg: Edition Nautilus.
Gebesmair, A. & Nölleke-Przybylski, P. (2020). Schlüsselaspekte der Medienproduktion. In J. Krone, T. Pellegrini, (Hrsg.), Handbuch Medienökonomie. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-09560-4_18
Gonser, N. & Gundlach, H. (2019). Zum Wert der Wertschätzung von Public-Service-Medien. In J. Krone & A. Gebesmair (Hrsg.), Zur Ökonomie gemeinwohlorientierter Medien: Massenkommunikation in Deutschland, Österreich und der Schweiz (S. 161–186). Baden-Baden: Nomos. https://doi.org/10.5771/9783845289601-159
Jandrić, P. (2023). Postdigital. In Encyclopedia of Postdigital Science and Education (S. 1–5). Cham: Springer Nature.
Jarren, O. (2016). Ein Grundlagenfach. In J. Müller-Lietzkow & F. Sattelberger (Hrsg.), Empirische Medienökonomie (S. 97–104), Baden-Baden: Nomos.
Klein, K. (2019). Postdigital Landscapes. Online Zeitschrift Kunst Medien Bildung zkmb. Abgerufen am 24.09.2024 von https://zkmb.de/wp-content/uploads/2019/10/Postdigital-Landscapes.pdf
Kölmel, M.-J. & Sumi, D. H. (2024). (Post)Digitalität in den Künsten. In Handbuch Kulturpolitik (S. 1-14). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Kops, M. (2016). Der Rundfunk als privates und öffentliches Gut: 25 Jahre Institut für Rundfunkökonomie. Leipzig: Vistas Verlag.
Mierzejewska, B. & Kolo, C. (2019). Economics of information and cultural goods. In: A.B. Albarran (Hrsg.), A Research Agenda for Media Economics (S. 77–102). https://doi.org/10.4337/9781788119061.00011
Musgrave R. A. (1957). A multiple theory of budget determination. Finanzarchiv, N.F., 17(3), 333–343.
Picard, R. G. (2006). Comparative aspects of media economics and its development in Europe and in the USA. Media economics in Europe, 15–23.
Prokop, D. (Hrsg.) (1973). Massenkommunikationsforschung 2: Konsumtion. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch.
Rau, H. (Hrsg.) (2014). Digitale Dämmerung: Die Entmaterialisierung der Medienwirtschaft. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
Rau, H. (2022). Media Meritocracy. A Question of Preferences: Interpretations of the Context of Need Decide on the Supply Policy of Mass Media. In J. Krone & T. Pellegrini (Hrsg.), Handbook of Media and Communication Economics. Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34048-3_9-2
Wellbrock, C.-M. & Buschow, C. (2020). Money for Nothing and Content for Free? Paid Content, Plattformen und Zahlungsbereitschaft im digitalen Journalismus. Baden-Baden: Nomos.
Wellbrock, C.-M. & Zabel, C. (2020) (ed.): Innovation in der Medienproduktion und –d istribution. Proceedings der Jahrestagung der Fachgruppe Medienökonomie der DGPUK 2019, Köln.