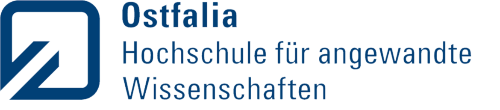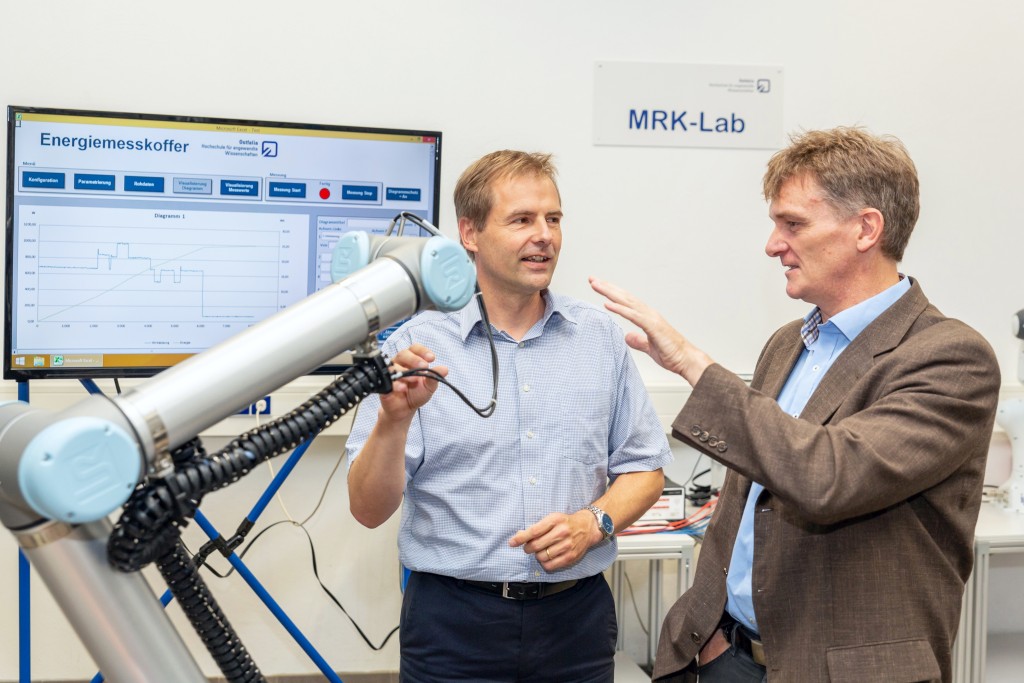Dieses Ziel ist eine der großen Herausforderungen, vor denen unsere Welt steht:
Energieversorgung und Energieverbrauch sollen klimafreundlicher werden. Nachhaltigkeit und
Umweltverträglichkeit spielen für das Forschungsfeld "Erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz"
der Ostfalia eine wichtige Rolle. Im Interview sprechen die Professoren Holger Brüggemann und Lars
Kühl darüber, mit welchen Projekten sie sich beschäftigen und wer von ihnen profitiert. Und sie
erklären, warum das Forschungsfeld ihre Arbeit bereichert.
Herr Professor Brüggemann, Herr Professor Kühl, wie viel Energie können Unternehmen in der
Produktion einsparen?
Holger Brüggemann: In unseren Projekten machen wir die Erfahrung, dass Unternehmen ihren
Verbrauch um bis zu 30 Prozent senken können. In Niedersachsen sind die Bereiche Industrie,
Gewerbe, Handel und Dienstleistungen für mehr als 40 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs
verantwortlich. Das zeigt, wie groß das Potenzial ist, das wir bisher nicht ausschöpfen.
Warum ist es wichtig, dass wir mit unserer Energie sparsamer umgehen?
Holger Brüggemann: Wir haben uns hohe Klimaschutzziele gesetzt. Der Masterplan für den Großraum
Braunschweig sieht vor, dass wir in unserer Region bis zum Jahr 2050 den Energieverbrauch um die
Hälfte und die Treibhausgasemission um 95 Prozent verringern wollen. Niedersachsen- und
deutschlandweit gibt es ähnliche Pläne. Um diese Ziele zu erreichen, gibt es im Grunde nur zwei
Wege. Erstens brauchen wir mehr regenerative Energiequellen. Und zweitens müssen wir die
Energieeffizienz deutlich erhöhen – und genau damit beschäftige ich mich im Produktionsumfeld.
Lars Kühl: Ich befasse mich mit dem Einsatz regenerativer Energien in Gebäuden – zur Versorgung
mit Wärme, Kälte und Strom. Geothermie und Solarthermie, Wärmepumpen und Photovoltaik: Das sind nur
einige Stichwörter für den großen Themenbereich, den wir mit unseren Forschungsprojekten abdecken.
Und den wir auch in die Lehre tragen: Die Erkenntnisse aus unseren Projekten geben wir an die
Studierenden weiter. Immer wieder finden Vorlesungen vor Ort in Unternehmen und Gebäuden statt. Bei
laufenden Prozessen können Studierende Optimierungsmaßnahmen verfolgen – sozusagen live und in
Farbe. Auch diese Nähe von Forschung und Lehre macht unsere Projekte so spannend.
Warum beschäftigen sich nicht noch mehr Unternehmen mit regenerativen Energien und
Energieeffizienz?
Holger Brüggemann: Viele unterschätzen, welche Möglichkeiten es gibt, Energie einzusparen. Sie
wissen zwar, dass Druckluftwerkzeuge nicht besonders effizient sind und Leckagen eine Verschwendung
von Ressourcen sind. Doch dass sie durch den Austausch eines Druckluftschraubers gegen einen
elektrischen Schrauber 90 Prozent weniger Energie verbrauchen, überrascht sie. Viele kleine und
mittelständische Unternehmen sind außerdem gut ausgelastet. Ihnen fehlt häufig die Zeit, sich mit
diesem Thema zu befassen.
Und da kommen Sie ins Spiel?
Lars Kühl: Ja, es liegt auch an uns, sie darüber zu informieren, welche Einsparpotenziale es
gibt und wie man sie nutzen kann. Wir gehen in Betriebs-, Büro- und Wohngebäude, statten sie mit
Messtechnik aus und decken die Strom-, Wärme- und Kälteverbräuche auf. Im Anschluss daran erklären
wir, wie regenerative Energien und Effizienzmaßnahmen die Energieverbrauchskennwerte verbessern.
Wir entwickeln auch Konzepte für die energetische Versorgung ganzer Gebäude. Der Neubau der
Braunschweiger Druckerei Oeding ist ein Plusenergie-Gebäude, das seine eigene Energie erzeugt. Für
die Planung des Gebäudes hat die Ostfalia einen wichtigen Beitrag geleistet.
Woran haben Sie noch mitgewirkt?
Holger Brüggemann: Am Aufbau der Niedersächsischen Lernfabrik für Ressourceneffizienz an der
Ostfalia. Aus diesem Projekt ist ein gemeinnütziger Verein entstanden, in dem sich viele Partner
engagieren und viele Mitarbeiter aus Unternehmen geschult wurden. So haben wir vielen Unternehmen
neue Mittel und Wege aufzeigen können, wie sie die Energieeffizienz verbessern. Im Bereich der
Robotik haben wir gemeinsam mit der Volkswagen AG ermittelt, welche Einflüsse auf den
Energieverbrauch wirken. Verändert man die Programmierung der Roboter, kann man bis zu 40 Prozent
der Energie einsparen.
Wer beteiligt sich an Ihrem Forschungsfeld?
Lars Kühl: In unserem Forschungsfeld arbeiten zuallererst die Ostfalia-Fakultäten Maschinenbau,
Versorgungstechnik und auch Fahrzeugtechnik und Elektrotechnik mit. Denn ein wichtiges Thema ist
die Elektromobilität: Aus den Fahrzeugen können wir Speicherkapazitäten in die Energieversorgung
von Gebäuden integrieren. Auch außerhalb der Ostfalia sind wir gut vernetzt: über den Kontakt mit
anderen Hochschulen, Industrieunternehmen, Planungsbüros sowie Wohnbauträgern und Kommunen können
wir etwa die Themenbereiche Hochbau und Architektur, Regelungstechnik und Messtechnik einbinden.
Wir bewegen uns so am Stand der Technik in realen Projekten und orientieren uns am Bedarf der
Nutzer.
Holger Brüggemann: Zugute kommt uns, dass die Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 in den
Unternehmen eine große Rolle spielen. Wer die Produktion digitalisiert, erkennt auch im
Energiebereich schon nach kurzer Zeit wesentliche Fortschritte. Unser Forschungsfeld profitiert
davon, dass die Ostfalia in der Digitalisierung stark aufgestellt ist.
Lars Kühl: Wichtig ist, dass es eine Schnittstelle zu den Sozialwissenschaftlern gibt. So
untersuchen wir, wie die Optimierungsmaßnahmen und der Umgang mit modernen Technologien bei den
Nutzern die nötige Akzeptanz finden können.
Warum bereichert das Forschungsfeld Ihre Arbeit?
Holger Brüggemann: Weil ich dazu beitragen kann, dass wir unsere Klimaschutzziele erreichen. Und
weil Investitionen in die Energieeffizienz von Maschinen und Anlagen in der Regel auch dazu führen,
dass die Produktivität steigt. So verbessern wir über den sinkenden Energieverbrauch auch die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. In meinen Augen ist das eine sehr sinnvolle Aufgabe …
Lars Kühl: … zumal wir die energiesparenden Maßnahmen nicht nur umsetzen. Sondern auch die
vielen Möglichkeiten, die erneuerbare Energien und Energieeffizienz bieten, über die Lehre an
unsere Studierenden weitergeben. So sorgen wir dafür, dass unsere Forschungsarbeit nachhaltig
wirkt.